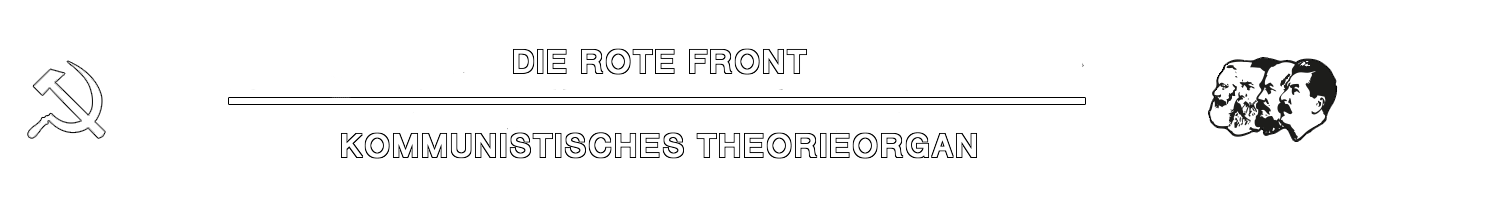Arbeiterführersystem oder kollektives Leitsystem?
Liebe Leser, die folgende Analyse des Arbeiterführerystems stammt vom Februar 2023. Sie wurde intern herumgereicht. Da diese nicht an Aktualität und Wichtigkeit verloren hat, veröffentlichen wir sie nun zu diesem Zeitpunkt.
Es gibt eine Theorie aus der DVRK, welche bei Genossen im Westen Aufsehen erregt: Die Arbeiterführertheorie. Es gibt einige, die den Kurs der Partei der Arbeit Koreas kopieren wollen, einschließlich dieses Prinzips. Dies geschieht wohl aus Bequemlichkeit, da diese Personen sich entweder selbst keine Gedanken machen wollen oder darauf spekulieren, dass die Mehrheit der Massen sich keine Gedanken machen wollen würde. Egal wie herum der Ansatz ist, er versucht das fortschrittliche Erbe der Aufklärung rückgängig zu machen. Kant schrieb einst: „Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben; und warum es anderen so leicht ward, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein.“1 Nur Befehle anderer ausführen zu müssen und sich auf diese zu berufen war historisch fatal für das deutsche Volk. Und es ist auch aus marxistischer Sicht nicht zu begründen. Nun zum Wesentlichen.
Was ist die ideologische Grundlage des Arbeiterführersystems? Ursprünglich stammt sie aus der Spätzeit von Kim Il Sungs Amtszeit. Nach 1990 suchte er offenbar nach einer Erklärung, wieso die DVRK auf dem Kurs des Sozialismus geblieben ist und fast die gesamten anderen sozialistischen Staaten revisionistisch und später kapitalistisch geworden sind. „Die Revolution kann erst dann siegreich voranschreiten, wenn die Volksmassen sich fest um ihren Führer zusammenschließen und seine Führung in aller Treue unterstützen.“2, behauptete Kim Il Sung. In der KP Chinas seit Deng bezeichnet man einen solchen Führer als „Kern“. Der Unterschied zu China ist aber, dass in der KP Chinas die Generalsekretäre laut innerparteilicher Knigge alle zehn Jahre wechseln sollen. Dies ist in der PdAK nicht so. „Die wichtigste Mission eines Führers der Revolution ist es, den revolutionären Leitgedanken zu entwickeln und den Weg zur souveränen Sache der Volksmassen klar zu beleuchten.“3, sagte Kim Il Sung. Wie im nachfolgenden Abschnitt ersichtlich wird, hatte er dabei Kim Jong Il im Kopf. Ideologisches Denken ist hier kein kollektiver Prozess, sondern bloß das eines einzigen Mannes. Es gibt dabei kein Kollektiv, aus dessen Mitte heraus entschieden wird, sondern ein Kollektiv, das sich um den „Arbeiterführer“ scharen soll. Damit nicht genug. Kim Il Sung versuchte sogar seine Theorie auf Stalin zurückzuführen. Er sagte: „Die UdSSR richtete Gorbatschow zugrunde, aber deren Zersetzung begann in der Zeit Chruschtschows. Unter Berufung auf die Einwände gegen den ´Personenkult´ hatte er böswillig Stalin verunglimpft und die Rolle eines Führers in der Revolution abgelehnt. Von jener Zeit an verschwand in der Partei der Sowjetunion das Zentrum der Führungstätigkeit. Wenn eine Partei der Arbeiterklasse dieses Zentrum verliert und nicht von einem Führer geführt wird, ist sie außerstande, die Revolution und den Aufbau in richtiger Weise zu führen, da ihre Kampfkraft gelähmt ist.“4 Stalin sah sich aber keineswegs als alleiniger „Führer der Revolution“, sondern als Teil des Kollektivs. Kim Il Sungs Blick auf Stalin ist verzerrt. Es handelt sich um eine bloße Spiegelung von Chruschtschows Vorwürfen gegen ihn, nicht um eine kritische Überprüfung dieser. Die KP Chinas unter Mao prüfte dessen Anschuldigungen kritisch, kam aus diesem Grund zu deren Ablehnung und zu einer anderen Sicht auf Stalin. Nun aber zu Beispielen von Stalins Denken.
Stalin sagte im Dezember 1931 gegenüber Emil Ludwig: „Eine einzelne Person darf nicht entscheiden. Entscheidungen einer einzelnen Person sind immer oder fast immer einseitige Entscheidungen. In jedem Kollegium, in jedem Kollektiv gibt es Menschen, mit deren Meinung man rechnen muss. In jedem Kollegium, in jedem Kollektiv gibt es Menschen, die auch falsche Meinungen zum Ausdruck bringen können. Auf Grund der Erfahrungen von drei Revolutionen wissen wir, dass unter hundert Entscheidungen, die von einzelnen Personen getroffen und nicht kollektiv überprüft und berichtigt wurden, annähernd neunzig Entscheidungen einseitig sind.“5Außerdem wollte Stalin den Posten des Generalsekretärs des ZK der KPdSU abschaffen und alleinig durch das Leitungskollektiv ersetzen6. Die KP Chinas unter Mao sah das ähnlich wie Stalin: „Die Stärkung der kollektiven Führung ist eine wichtige Voraussetzung für die Verwirklichung des demokratischen Zentralismus in der Partei; eine wichtige Garantie für den Aufbau der zentralisierten Führung der Partei.“7 Das Arbeiterführersystem widerspricht also dem marxistischen Konsens über die Leitungstätigkeit von Partei und Staat. Man kann das Arbeiterführersystem sogar polemisch als „Arbeiter-Führerprinzip“8 bezeichnen, denn inhaltlich fordert es die Etablierung des Führerprinzips im Sinne der Arbeiterklasse. Die Arbeiterklasse spielt dabei die Rolle der Gefolgschaft, nicht des Subjekts. Die PdAK behauptet das Gegenteil. Wie soll aber etwas Subjekt sein, wenn die gleichberechtigte kollektive Mitarbeit nicht ermöglicht wird? Würde sie ermöglicht werden, dann gäbe es das Arbeiterführersystem gar nicht.
Das Arbeiterführersystem ist nicht alleinig aus dem Vorwurf des Personenkults zu erklären. Um Kim Il Sung gab und gibt es Personenkult, wie auch um Kim Jong Il und Kim Jong Un (wobei dieser bei ihm nicht so extrem ist, wie unter seinem Vater). Um Kim Il Sung erwuchs ein Personenkult aus seinen Leistungen für die Befreiung Koreas und den sozialistischen Aufbau. Selbst wenn man, wie es offenbar Kim Il Sung gegenüber Stalin tut, den anderen sozialistischen Staatschefs vorwirft, dass sie „Arbeiterführer“ gewesen seien, weil es einen Personenkult um sie gegeben hat, so erklärt dieser gewisse Charakteristiken des Arbeiterführersystems nicht. Auch Hans Maretzki, der letzte DDR-Botschafter in der DVRK, sah den Personenkult nicht als ausschlaggebend9. Stattdessen nannte er eine „asiatisch-feudale Kluft der Unterordnung und Servilität“10 als Hintergrund. Was ist wohl damit gemeint? Die Sitten des Konfuzianismus. Offiziell bekämpfte die PdAK den Konfuzianismus. Dennoch konnte auch sie in Jahrzehnten keine Jahrhunderte in den Köpfen umpflügen. Der Neokonfuzianismus war im feudalen Korea sogar so stark ausgeprägt, dass nicht nur der traditionelle koreanische Schamanismus (Musok) als Religion unterdrückt worden ist, sondern auch der Buddhismus. „Pietät und Gehorsam sind die Wurzeln des Menschentums.“11, steht in den Gesprächen des Konfuzius. Gemeint damit ist Kindespietät (Gehorsam gegenüber den Eltern) und Gehorsam gegenüber dem Lehnsherren beziehungsweise dem Herrscher. Der Personenkult in der DVRK ist nicht nur auf Kim Il Sung, Kim Jong Il und Kim Jong Un beschränkt. Kim Jong Suk, die Ehefrau Kim Il Sungs, die Kim Jong Il gebar, wird als „Mutter Koreas“ verehrt. Den Titel „Mutter Koreas“ trägt aber auch Kim Il Sung Mutter Kang Ban Sok12. Und damit ist der Kult um Familienmitglieder von Kim Il Sung noch nicht abgeschlossen. Die genannten Namen sind nur die Hauptpersonen. Kim Il Sungs Vater Kim Hyong Jik findet auch gelegentlich Erwähnung. Diese Art von Familienkult ist beispiellos in den sozialistischen Ländern. Woher rührt dieser? Er hat seine Wurzeln in der Kindespietät. Im konfuzianistischen Buch der Ehrfurcht steht geschrieben: „Wenn der Herrscher seine Eltern liebt, so wird unter den Menschen niemand es wagen, die seinigen zu hassen. Wenn er seine Eltern ehrt, so wird unter den Menschen niemand es wagen, die seinigen zu mißachten. Dadurch, daß er seinen Eltern dient mit der höchsten Liebe und Achtung, wird es geschehen, daß der bildende Einfluß seines Geistes sich erstreckt auf alle Untertanen und Gesetz wird auf der ganzen Welt. Das sind die Grundzüge der Ehrfurcht des Himmelssohns.“13 Diese Worte soll Konfuzius persönlich gesagt haben. Genauso auch diese: „Dreitausend verschiedene Straftaten gibt es; aber der Verbrechen größtes ist es, keine Ehrfurcht zu haben.“14 Die Kindespietät gilt also im Konfuzianismus als mithin das höchste Prinzip überhaupt. Das kommt daher, dass im Konfuzianismus die Familie als „Staat im Kleinen“ angesehen wird. Wenn einige Genossen aus dem Westen das Arbeiterführersystem dadurch beschönigen, indem sie deren Charakteristiken auf die Kultur schieben, so untertreiben sie damit. Es handelt sich dabei um ideologische Überreste feudalen konfuzianistischen Denkens. Keiner soll behaupten, diese gäbe es in Korea nicht mehr. Selbst im Jahre 1931 stellte Stalin fest, dass in Europa noch feudale „Herrenmanieren“ existieren würden15. Eine Kulturrevolution braucht Generationen, nicht bloß ein paar Jahrzehnte.
Das Arbeiterführersystem ist für uns nicht gangbar. Es kommt einem Wunder gleich, dass in der DVRK dieses Prinzip bisher zwei Generationenwechsel überstanden hat, ohne kapitalistische Restauration. Das Gefährliche bei dem System ist, dass es die ganze Sache von einer einzigen Person abhängig macht. Im konfuzianistischen Buch der Urkunden steht: „Ein Staat kann von einer einzigen Person zugrunde gerichtet werden. Er kann genauso zu Ruhm geführt werden durch eine einzige Person.“16 Alles steht mit einer Person, alles fällt mit einer Person. So ein System hat keine Stabilität und sorgt erst recht für Karrierismus. Dies gilt auch, wenn sich die Nachkommen des „Führers“ sich um die Nachfolge streiten sollten, bei einer Vergabe im Kreis der Familie. Das wäre Nepotismus in der Ämtervergabe. Wir sollten die DVRK aber nicht offen wegen dem Arbeiterführersystem attackieren. Noch sind sie sozialistisch und es ist sehr unwahrscheinlich, dass die PdAK ihren Kurs bereit wäre zu ändern, wenn Ausländer sie kritisieren. Konfuzius sagte: „Irrlehren anzugreifen, das schadet nur.“17 Das ist kein Aufruf zu blindem Opportunismus. Unsere Kritik an Fehlern und Mängeln der DVRK und der PdAK sollte intern sein, solange das Land sozialistisch ist. Wir sollten lediglich beachten, dass wir an der Situation nichts unmittelbar ändern können und beim Verbreiten unserer Thesen uns lediglich an einem Nebenkriegsschauplatz abmühen.
Das Arbeiterführersystem entspricht nicht Walter Ulbrichts Forderung nach einer „wissenschaftlichen Leitung“. Hans Maretzki kritisierte, wohl nicht zu unrecht, dass im Arbeiterführersystem Fachleute die „höchsten Laien“ überzeugen müssten18. Schließlich ist ein politisches Amt keine Qualifikation. Ulbrichts „wissenschaftliche Leitung“ setzt ein Kollektiv aus qualifizierten Kadern voraus. Ulbricht ging dieses Problem im Verlauf der 60er Jahre an, aber bekam es bis zur Absetzung durch die Honecker-Clique nicht gelöst. Es obliegt uns, ein kollektives Leitsystem auszuarbeiten, in welchem keine Einzelperson aufs Schild gehoben wird, sondern jeder seinen gleichwertigen Teil zum Ganzen beiträgt. Wenn außerdem dieser einzelne „Arbeiterführer“ stirbt, so verliert man das Führungszentrum. In einem Leitungskollektiv gleicht sich das aus. Einzelpersonen kommen und gehen, ohne dass die Kontinuität der Führung gefährdet wäre. Wir sollten uns an Stalins Reformplänen orientieren, die Vorsitzendenposten abzuschaffen, und stattdessen die Sitzungsleitungen reihum rotieren zu lassen. Personenkult projiziert letztendlich eine Kollektivleistung auf eine Einzelperson und sendet das falsche Signal, dass ein Einzelner alles zugleich könnte. Auch sollten wir bei der Umsetzung konsequent sein bis auf die unterste Ebene von Partei und Staat, um so die Massen langfristig zu aktivieren. Hier sind wir zurück bei Kants Forderung, dass niemand aufgrund von (Denk-)Faulheit meint, ein anderer würde schon seine Aufgabe übernehmen. Das werktätige Volk kann nur der Souverän sein, wenn es aktiv im kollektiven Leitsystem des demokratischen Zentralismus eingebunden ist.
Das ist die Aufgabe, die sich uns stellt. Aus diesem Grund müssen wir die Arbeiterführertheorie ideologisch bekämpfen.
1Immanuel Kant „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ (30. September 1784) In: „Was ist Aufklärung? – Thesen, Definitionen, Dokumente“, Philipp Reclam jun., Stuttgart 2010, S. 9.
2„Möge die Jugend unter Führung der Partei unsere revolutionäre Sache vollenden“ (22. Februar 1993) In: Kim Il Sung „Werke“, Bd. 44, Verlag für fremdsprachige Literatur, Pyongyang 2006, S. 95 (E-Book).
3„Für die Fortsetzung und Vollendung des sozialistischen Werkes“ (13. März 1992/20. Januar 1993/3. März 1993) In: Ebenda, S. 110.
4„Unter den Auslandskoreanern aktiv die Bewegung zur Vereinigung des Vaterlandes entfalten“ (6. Juni 1993) In: Ebenda, S. 179.
5„Unterredung mit dem deutschen Schriftsteller Emil Ludwig“ (13. Dezember 1931) In: J. W. Stalin „Werke“, Bd. 13, Dietz Verlag, Berlin 1955, S. 95.
6Siehe: Grover Furr „Chruschtschows Lügen“, Das Neue Berlin, Berlin 2014, S. 275 ff. Bereits am 19. Dezember 1927 startete Stalin einen Versuch, den Posten des Generalsekretärs auf einem ZK-Plenum abzuschaffen. Er scheiterte damals und zukünftig am Widerstand der anderen ZK-Mitglieder.
7Zhang Chunqiao [u.a.] „Ein grundlegendes Verständnis der Kommunistischen Partei Chinas“, o. Hrsg. [InfraRot Medienkollektiv], o.O. u. J. [2021], S. 139.
8Siehe: Hans Maretzki „Kim-ismus in Nordkorea – Analyse des letzten DDR-Botschafters in
Pjöngjang“, Anita Tykve Verlag, Böblingen 1991, S. 98
9Siehe: Ebenda, S. 97.
10Ebenda, S. 107.
11Lunyü I, 2 In: Konfuzius „Gespräche“, Deutscher Taschenbuch Verlag/Verlag C. H. Beck,
München 2007, S. 7.
12Siehe bspw.: „The Mother of Korea“, Foreign Languages Press, Pyongyang 1978, S. 326,
Englisch.
13Xiaojing 2 In: „Hiau Ging – Das Buch der Ehrfurcht“, Verlag der Pekinger Pappelinsel, Peking 1940, S. 2.
14Xiaojing 11 In: Ebenda, S. 13.
15Vgl. „Unterredung mit dem deutschen Schriftsteller Emil Ludwig“ (13. Dezember 1931) In: J. W. Stalin „Werke“, Bd. 13, Dietz Verlag, Berlin 1955, S. 102.
16Ansprache des Herzog von Qin In: „The Most Venerable Book – Shang Shu“, Penguin Books, London 2014, S. 185, Englisch.
17Lunyü II, 16 In: Konfuzius „Gespräche“, Deutscher Taschenbuch Verlag/Verlag C. H. Beck, München 2007, S. 17.
18Vgl. Hans Maretzki „Kim-ismus in Nordkorea – Analyse des letzten DDR-Botschafters in Pjöngjang“, Anita Tykve Verlag, Böblingen 1991, S. 105.