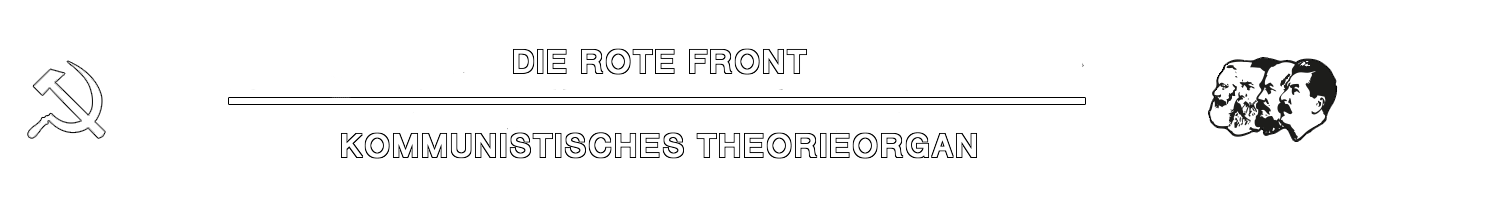Vom Milchbubi zum Guillotineur – Robespierres Sicht auf die Todesstrafe und die Bedeutung für heute
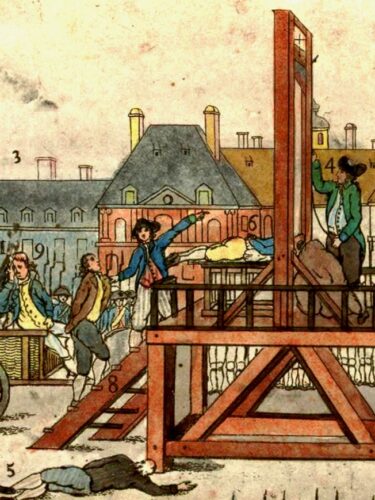
Seit der Zeit der Aufklärung, also dem Vorabend der Französischen Revolution, steht die Todesstrafe immer wieder im Zentrum von Debatten. Sie wird von Liberalen als abgeschlossen betrachtet zugunsten deren Abschaffung, aber das ist bloß eine Fiktion ihrerseits. Bevor wir aber zum titelgebenden Robespierre übergehen, sollten erst einmal einige ideologischen Grundsätze dargelegt werden, die zur damaligen Zeit kursierten.
Es dürfte bekannt sein, dass die Bibel die Todesstrafe auf Mord bejaht, auch wenn die heutigen Christen dieser Frage möglichst ausweichen oder gar verlogenerweise das Gegenteil behaupten. Sie versuchen das Christentum dem Liberalismus anzupassen, dabei steht unmissverständlich geschrieben:
“Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll um des Menschen willen vergossen werden; denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht.”1
Diese biblischen Anschauungen prägten auch die bürgerlichen Denker der Periode des klassischen Liberalismus. John Locke zum Beispiel hatte die Eigenschaft, Bibelstellen des öfteren zu zitieren, um seine Gedanken zum Naturrecht zu “belegen”.
John Locke schrieb in seinen “Abhandlungen über den Staat”:
“Unter politischer Macht verstehe ich ein Recht auf Erlaß von Gesetzen unter Androhung der Todesstrafe (und folglich auch aller minderen Strafen) zur Regelung und Erhaltung des Eigentums sowie zur Anwendung der staatlichen Gewalt im Interesse der Vollstreckung solcher Gesetze und der Verteidigung des Gemeinwesens gegen Unrecht von außen, und all dies einzig zum gemeinen Wohl.”2
Letztlich begründet sich die staatliche Autorität darauf, im Zweifelsfall einem Individuum der Gesellschaft das Leben nehmen zu können. Diese Tatsache war früher eine Trivialität, heutzutage muss sie aber bekräftigt werden, als sei sie eine Neuheit. Dabei ist sie ein Lehrsatz des klassischen Liberalismus gewesen.
Voltaire sprach sich für die Abschaffung der Todesstrafe aus, aber das Beispiel, das er lieferte, waren nicht Mörder, sondern zum Tode verurteilte Diebe3. Es ist ersichtlich, dass die Todesstrafe auf Diebstahl völlig über jegliches Maß an Gerechtigkeit hinausgeht. Dennoch ist mit diesem Beispiel nichts bewiesen. Voltaires Argumentation ist auf schwachen Füßen, weil er versuchte, die Todesstrafe per se zu delegitimieren, während er bloß gegen die Bestrafung von Dieben mit dem Tode argumentierte. Das ist weder fundiert noch allumfassend.
Das ist, in ziemlicher Kurzfassung, was damals kursierte. Robespierre war klar vom Geist der Aufklärung geprägt.
Am 30. Mai 1791 hielt er vor der Nationalversammlung eine herzzerreißende Rede über die Todesstrafe, in welcher er für deren Abschaffung plädierte.
Er lehnte die Todesstrafe aus zwei Gründen ab: Sie sei “grundsätzlich ungerecht” und dazu noch “nicht die härteste aller Strafen”, die dazu noch “Verbrechen eher fördern als verhüten” würde4.
Die Gesellschaft habe nur das Recht der “Wiedergutmachung persönlich zugefügten Unrechts” und dass die Tötung eines Menschen nur aus Notwehr erlaubt sei, es wäre sonst eine “maßlose Wiedergutmachung”5. Robespierre scheint den Sinn der Todesstrafe nicht zu verstehen. Sie ist keine “Wiedergutmachung”. Wie Ludwig Kossuth sagte: “Das verlorene Leben gibt Gott nicht zurück.”6 Man kann mit der Todesstrafe nichts wiedergutmachen, denn die Todesstrafe belebt das Opfer nicht wieder. Engels nannte “unsre Todesstrafe” die “zivilisierte Form der Blutrache”7. Da ist etwas Wahres dran, wenn man die Todesstrafe als Vergeltung für Mord anwendet. Dadurch wird der Täter als Gefahr für die Gesellschaft ausgeschaltet. Das ist der eigentliche Sinn, der Schutz der Gesellschaft, nicht, wie Robespierre denkt, die Wiedergutmachung. Da liegt schon ein Fehler in seiner Argumentation.
Aus diesem falschen Denken heraus kam auch sein zweiter Einwand, den er prägnant auf diese Weise zum Ausdruck brachte: “Nein, der Tod ist nicht immer das größte aller Übel für den Menschen.”8 Er betrachtet die Todesstrafe bloß vom Standpunkt des Individuums, nicht der Gesellschaft. Objektiv betrachtet ist der Tod die härtestmögliche Strafe, um eine Gefahr von der Gesellschaft abzuwenden. Ob das Individuum nun todessehnsüchtig ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle.
Er hat recht, wie auch Voltaire, wenn die übermäßige Anwendung der Todesstrafe der Regierung mehr schadet als nützt9. Deshalb sollte sie auch nur für Mord, Terrorismus und Landesverrat angewandt werden.
Robespierre versuchte auch zu argumentieren, dass die Todesstrafe die Anzahl schwerer Verbrechen nicht senke10. Dieser Punkt ist aber ebenfalls irrelevant. Es geht hierbei um das Prinzip, nicht um die Statistik. Diese ist bei ihm ohnehin mit äußerster Vorsicht zu genießen, denn er behauptet, dass gerade in Japan die Todesstrafe und schwere Verbrechen grassieren würden. Es geht nicht darum, ob die Anzahl der Verbrechen reduziert wird, sondern, ob Volksfeinde damit ausgeschaltet werden, sodass die Sicherheit der Gesellschaft gewährleistet wird.
In das anthropologische Feld rückt Robespierre vor, wenn er fragt: “Ist der Mensch etwa ein primitives Tier, das nur die Angst vor dem Tod oder vor körperlichen Qualen zu rühren vermag?”11 Nun, einige Menschen sind sicherlich derartig beschaffen. Mörder und Terroristen erreicht man sicherlich nur noch mit diesem letzten Mittel.
Man sollte nicht glauben, dass Robespierre ein idealistischer Träumer gewesen wäre, nur weil er sich derartig äußerte. Das Gegenteil war der Fall. Es ist eher so, dass aufgrund der bürgerlichen Geschichtsschreibung, die Robespierre ziemlich einseitig als ein blutrünstiges Monster, als einen regelrechten Dämonen darstellt, man ihm solche feinfühligen Gedanken nicht zutrauen würde.
Am 3. Dezember 1792 veränderte sich Robespierres Ton. Er erwähnte dort, dass er in der Nationalversammlung die Abschaffung der Todesstrafe forderte und nannte sie auch hier noch einmal “im allgemeinen ein Verbrechen”12. Er erkannte aber, dass Ludwig XVI. vom Gefängnis aus die Konterrevolution plante13. Entsprechend sagte er entgegen seiner persönlichen Haltung zur Todesstrafe: “Aber Ludwig muß sterben, weil das Vaterland leben muß.”14 Er forderte eine exemplarische Verurteilung als “Verräter an der französischen Nation” und “Verbrecher gegen die Menschheit”15. Danach wurde Robespierres allgemeiner Ton noch rauer.
Im März 1793 forderte Robespierre gegenüber abtrünnigen Generälen: “Statuiert ein furchtbares Exempel an den Schuldigen.”16 Jawohl, Robespierre lebte sich in seiner Rolle als Bezwinger der feudalistischen Konterrevolution ein.
In seiner Rede vor dem Nationalkonvent am 5. Februar 1794 wurde Robespierre noch deutlicher. Er sagte:
“Wenn in friedlichen Zeiten der Kraftquell der Volksregierung die Tugend ist, so sind es in Zeiten der Revolution Tugend und Terror zusammen. Ohne die Tugend ist der Terror verhängnisvoll, ohne den Terror ist die Tugend machtlos.”17
Damit erkannte Robespierre an, dass man noch so nette Tugenden haben kann, dass sie aber machtlos sind gegenüber konterrevolutionärer Gewalt ohne revolutionäre Gewalt. Lenin sagte: “Eine Revolution ist nur dann etwas wert, wenn sie sich zu verteidigen versteht.”18 Diese Worte verstand Robespierre bereits mehr als ein Jahrhundert vor ihrer Niederschrift.
Er gab auch zu, dass der Terror dem Despotismus ähnlich sei, aber die Ziele sich unterscheiden: Der Terror sei für die Republik, der Despotismus für die Tyrannei19 (so nannte Robespierre den Absolutismus). Der Terror sei nötig, um sich der Angriffe der Aristokratie zu erwehren, die nicht genug verfolgt worden sei20.
Robespierre warnte aber eindrücklich und nahm sein eigenes Ende gewissermaßen vorweg:
“Wehe dem, der es wagt, das Volk selbst mit Terror zu regieren; der Terror darf sich nur gegen seine Feinde richten!”21
Robespierre wollte die Todesstrafe nicht anwenden, wurde aber dazu durch die äußeren Umstände gedrängt. Es scheint, als hätte Marquis de Sade recht, wenn er schreibt:
“Da wir immer von einer Notwendigkeit bewegt werden, da wir immer Sklaven der Notwendigkeit sind, ist selbst der Augenblick, in dem wir unsere Freiheit am besten bewiesen zu haben glauben, zugleich auch derjenige, in dem wir am unüberwindlichsten fortgerissen wurden.”22
Jedenfalls handelte Robespierre entgegen seiner ursprünglichen Intention in der Frage der Todesstrafe und stattdessen entsprechend den Notwendigkeiten der damaligen materiellen Bedingungen.
Auch heute kann man auf die Todesstrafe nicht verzichten. Ich brauche wohl nicht im Detail ausführen, dass die Todesstrafe in den sozialistischen Staaten fortbestand. Marx und Engels sprachen relativ selten über die Todesstrafe, befürworteten sie aber als revolutionäres Mittel.
Engels schrieb im Februar 1840: “Es gibt keine Zeit, die reicher ist an königlichen Verbrechen, als die von 1816-1830; fast jeder Fürst, der damals regierte, hatte die Todesstrafe verdient.”23
Marx schrieb in seinem berühmten Werk “Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848-1850”: “Die blutigen Schrecken der ersten französischen Republik wurden desavouiert durch die Abschaffung der Todesstrafe für politische Verbrechen, die Presse wurde allen Meinungen freigegeben, die Armee, die Gerichte, die Administration blieben mit wenigen Ausnahmen in den Händen ihrer alten Würdenträger, keiner der großen Schuldigen der Julimonarchie wurde zur Rechenschaft gezogen.”24
Er empfand es also nicht als positiv, dass man die Todesstrafe für politische Verbrechen abschaffte. Die Todesstrafe für geringe Verbrechen wurden von Marx und Engels nicht befürwortet, für Klassenfeinde aber durchaus, wie man ersehen kann. Genauso sollten wir es auch halten.
Clara Zetkin sprach sich in einem Brief an Mathilde Wibaut vom September 1922 ausdrücklich für die Todesstrafe aus. Sie schrieb:
“Ins Politische übersetzt hat das Bibelwort seine Gültigkeit: ´Es ist besser, ein Mensch sterbe, denn daß das ganze Volk verderbe.´25 Der über einzelne verhängte Tod ist gewiß furchtbar, entsetzlich, aber er kann Hunderte, Tausende davor bewahren, von der Gegenrevolution gemeuchelt und erschlagen zu werden, im Bürgerkrieg zu fallen, er kann Millionen davor schützen, unter wiederaufgerichteter Knechtschaft zu verkümmern. Schlimmes kann Schlimmeres abwenden.”26
Unsere Haltung sollte derartig sein. Auch bei Mördern wird durch die Hinrichtung eines Einzelnen eine ganze Reihe von Menschen gerettet. Wenn man es so macht, wie es in der BRD üblich ist und entsprechende Täter durch lächerliche “Gutachten” freilaufen lässt, endet das wie am 25. Januar 2023 in Brokstedt27: Im Tod Unschuldiger. Resozialisation ist bei ihnen, wie man ersehen kann, absurd und bloßer Schutz von Tätern vor ihren Opfern. Aber die Aufgabe der Justiz sollte es sein, die Opfer vor den Tätern zu schützen und nicht umgekehrt. Und das drückt sich auch in der Ausschaltung von Gefahren für die Gesellschaft aus: Mörder, Terroristen und Landesverräter.
Genossen können gerne auf Robespierres Weise reden, solange sie dann auch wie Robespierre handeln. Alles andere ist an der Realität vorbei.
11. Mose 9, 6.
2“Abhandlungen über den Staat” (1679-1689) In: John Locke “Bürgerliche Gesellschaft und Staatsgewalt”, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1980, S. 98.
3Siehe: “Kommentar zu dem Buch ´Über Verbrechen und Strafen´” In: Voltaire “Schriften”, Bd. 2, Syndikat, Frankfurt am Main 1979, S. 55 ff.
4Vgl. “Über die Todesstrafe” (30. Mai 1791) In: Maximilien Robespierre “Ausgewählte Texte”, Merlin Verlag, Hamburg 1989, S. 55.
5Vgl. Ebenda, S. 55/56.
6Lájos Kossuth “Große Ministerrede vor dem Pester Landtag” (11. Juli 1848), Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 1998, S. 29.
7“Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates” (1884) In: Karl Marx/Friedrich Engels “Werke”, Bd. 21, Dietz Verlag, Berlin 1962, S. 96.
8“Über die Todesstrafe” (30. Mai 1791) In: Maximilien Robespierre “Ausgewählte Texte”, Merlin Verlag, Hamburg 1989, S. 60.
9Vgl. Ebenda, S. 61.
10Vgl. Ebenda, S. 62.
11Ebenda, S. 59.
12Vgl. “Über den Prozess gegen den König” (3. Dezember 1792) In: Ebenda, S. 327.
13Vgl. Ebenda, S. 322.
14Ebenda, S. 328.
15Vgl. Ebenda, S. 329.
16“Von den Gründen für unsere Rückschläge und von der Disziplin” (März 1793) In: Ebenda, S. 356.
17“Über die Grundsätze der politischen Moral” (5. Februar 1794) In: Ebenda, S. 594.
18“Bericht in der gemeinsamen Sitzung des Gesamtrussischen Zentralexekutivkomitees, des Moskauer Sowjets, der Betriebskomitees und der Gewerkschaften” (22. Oktober 1918) In: W. I. Lenin “Werke”, Bd. 28, Dietz Verlag, Berlin 1970, S. 115.
19Vgl. “Von den Gründen für unsere Rückschläge und von der Disziplin” (März 1793) In: Maximilien Robespierre “Ausgewählte Texte”, Merlin Verlag, Hamburg 1989, S. 594/595.
20Vgl. Ebenda, S. 600.
21Ebenda, S. 599.
22“Über die Freiheit” In: Marquis de Sade “Kurze Schriften, Briefe und Dokumente”, Merlin Verlag, Hamburg 1989, S. 491.
23Engels an Friedrich Graeber (9. Dezember 1839 – 5. Februar 1840) In: Karl Marx/Friedrich Engels “Werke”, Ergänzungsband II (Bd. 41), Dietz Verlag, Berlin 1967, S. 443.
24“Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848-1850” (1850) In: Ebenda, Bd. 7, Dietz Verlag, Berlin 1960, S. 22.
25Vgl. Johannes 11, 50.
26Brief an Mathilde Wibaut (September 1922) In: Clara Zetkin “Die Briefe 1914 bis 1933”, Bd. II, Karl Dietz Verlag, Berlin 2023, S. 389.